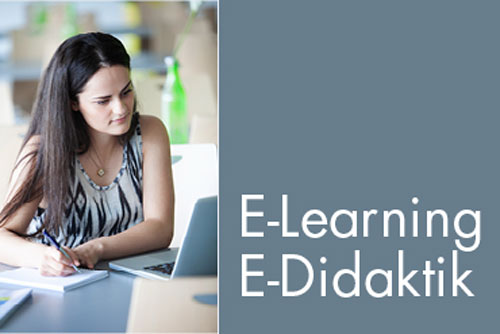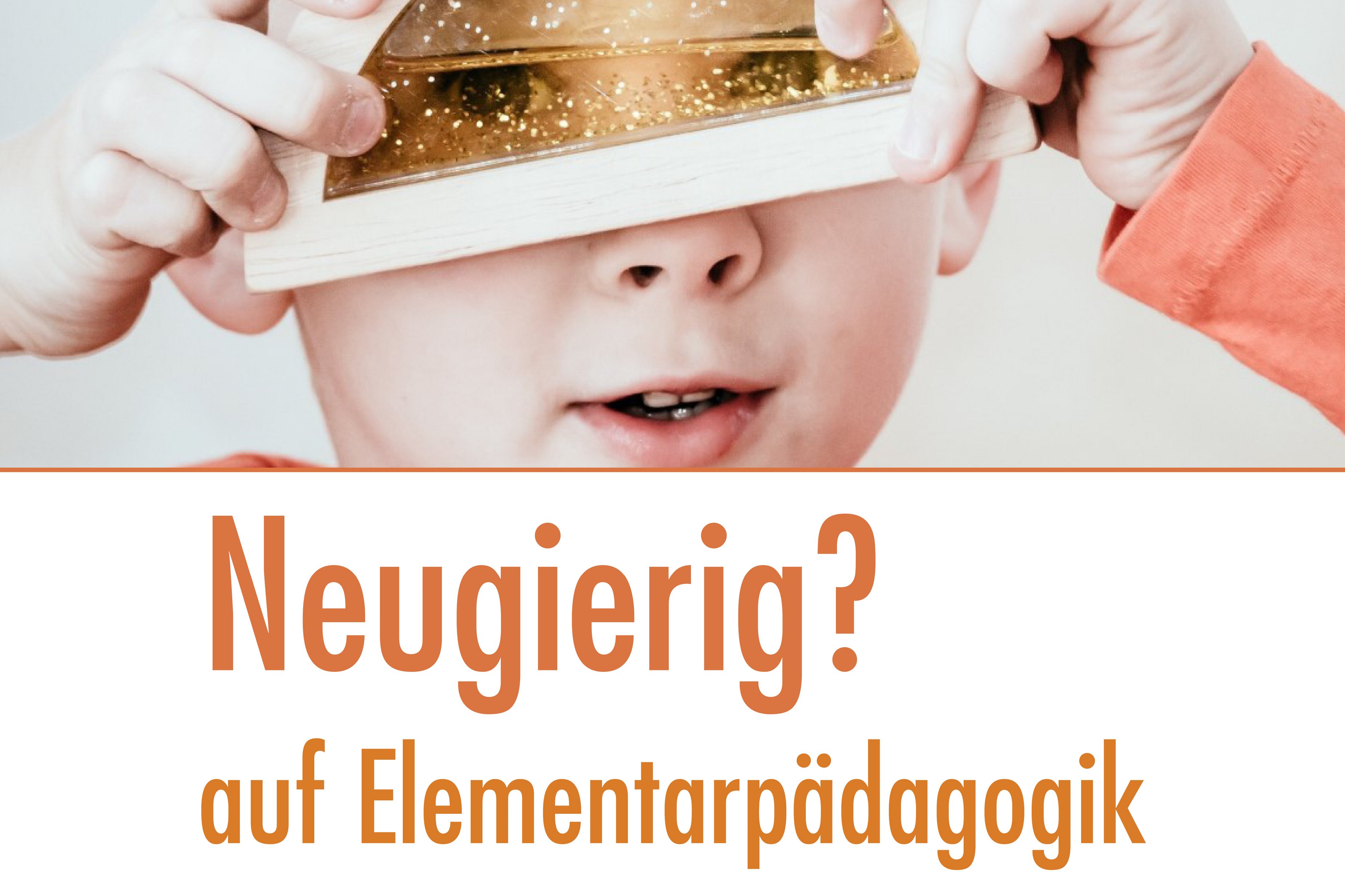Sommer, Sonne, Freibad – und überall braungebrannte, durchtrainierte Körper. Zumindest scheint es so. Wer selbst nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, fühlt sich schnell unwohl, besonders Kinder und Jugendliche. Unsicherheiten und Vergleiche gehören für viele zum Alltag dazu. Bodyshaming kann selbst diejenigen treffen, die eigentlich als „normal“ gelten. Doch was macht einen Körper attraktiv? Und warum lassen wir uns so sehr von gesellschaftlichen Erwartungen beeinflussen?
Attraktivität ist ein vielschichtiges Konzept, das sowohl universelle als auch individuelle Faktoren umfasst. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Menschen weltweit bestimmte Merkmale als attraktiv empfinden. Gleichzeitig spielt jedoch auch der individuelle Geschmack eine wesentliche Rolle. Der folgende Bericht gibt einen Überblick über zentrale Forschungsergebnisse zur Wahrnehmung von Attraktivität und beleuchtet sowohl allgemeingültige als auch kulturell und individuell bedingte Unterschiede.
Universelle Aspekte der Attraktivität
Forschungen zeigen, dass es weltweit geteilte Vorstellungen davon gibt, welche Merkmale als attraktiv gelten. Diese beinhalten:
- Jugendlichkeit: Menschen empfinden jüngere Gesichter als ansprechender, da sie biologisch mit Fruchtbarkeit und Vitalität assoziiert werden.
- Gesundheit: Makellose Haut, symmetrische Gesichtszüge und ein gesunder Körperbau sind universelle Attraktivitätsmerkmale.
- Geschlechtstypisches Aussehen: Frauen mit einer schmalen Taille und mittelbreiten Hüften sowie Männer mit v-förmigem Oberkörper gelten als besonders ansprechend.
Diese Merkmale sind evolutionär begründet, da sie mit überlebens- und fortpflanzungsbezogenen Vorteilen verbunden sind.
Individuelle und kulturelle Unterschiede
Neben den universellen Präferenzen beeinflussen auch individuelle und kulturelle Faktoren die Wahrnehmung von Attraktivität. Dazu zählen:
- Persönliche Erfahrungen: Menschen bewerten Gesichter positiver, wenn sie die abgebildete Person kennen oder über sie positive Informationen erhalten haben.
- Vergleichsmaßstäbe: Der Referenz-Effekt besagt, dass die Attraktivitätseinschätzung durch vorher betrachtete Gesichter beeinflusst wird.
- Kulturelle Prägungen: Körperideale variieren je nach Kultur. Beispielsweise bewerten Mitglieder der Zulu-Bevölkerung korpulentere Körper positiver als westlich geprägte Personen, die eher schlanke Körperformen bevorzugen. Diese Präferenzen können sich jedoch durch Migration und Medienkonsum verändern.
Einfluss der Medien und sozialer Kontexte
Die Medien spielen eine wesentliche Rolle bei der Formung von Attraktivitätsidealen. Der Mere-Exposure-Effekt beschreibt, dass Menschen, die häufig mit bestimmten optischen Reizen konfrontiert werden, diese zunehmend positiver bewerten. Dies führt dazu, dass Supermodel- und Prominenten-Schönheitsideale vermehrt als wünschenswert empfunden werden.
Zusätzlich beeinflussen Status und soziale Faktoren die Attraktivitätsbewertung. Personen mit einem hohen gesellschaftlichen Status werden in der Regel als anziehender wahrgenommen.
Methodische Herausforderungen in der Attraktivitätsforschung
Viele Studien zur Attraktivität basieren auf der Bewertung von Fotos. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass dynamische Faktoren wie Stimme, Mimik und Gestik ebenfalls eine Rolle spielen. Die Forschung bestätigt jedoch, dass der Attraktivitätseindruck ähnlich ausfällt, unabhängig davon, ob er anhand eines Fotos, eines Videos oder einer realen Begegnung entsteht.
Fazit
Attraktivität ist ein komplexes Zusammenspiel aus biologischen, kulturellen und individuellen Faktoren. Während einige Merkmale universell als attraktiv gelten, existieren dennoch erhebliche individuelle und gesellschaftliche Unterschiede in der Wahrnehmung von Schönheit. Die Forschung bietet wertvolle Einblicke in diese Dynamik, bleibt aber weiterhin ein spannendes und vielschichtiges Feld der Psychologie und Anthropologie.
Empfehlung
Fortbildung „Bodyshaming und Schönheitsideale – In-Themen bei Kindern und Jugendlichen“ am 5.5.2026 von 16-19.30 Uhr
Anmeldung ab Mai 2025 möglich!
Quelle: Gehirn & Geist 01/2025
Autorin: Hannah Haider