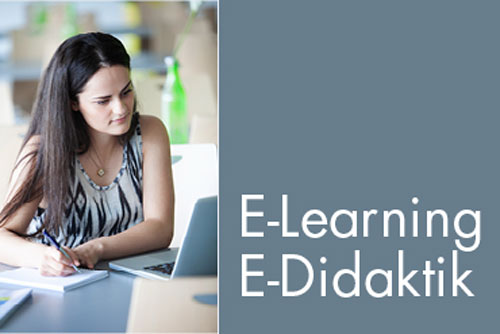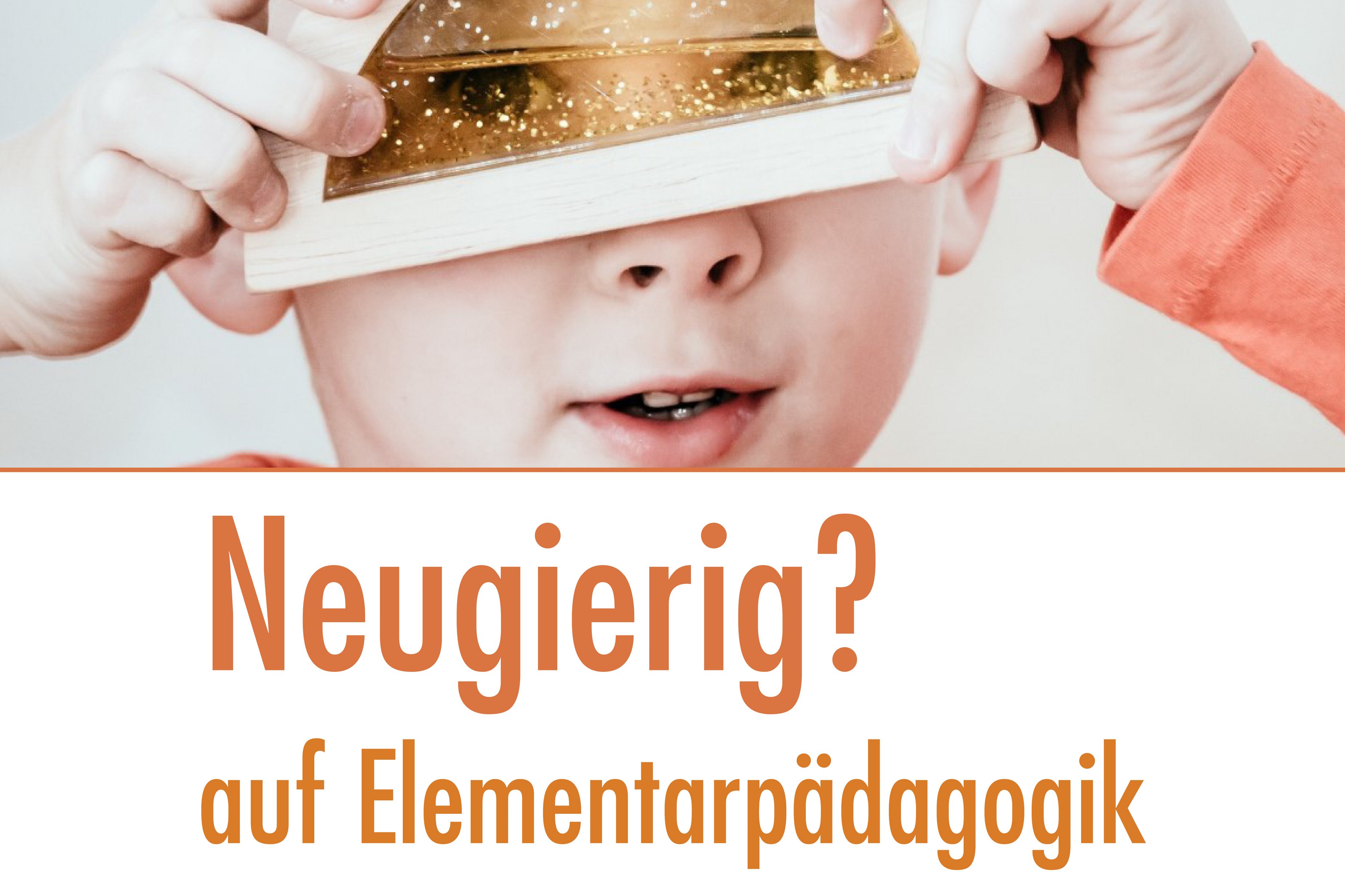Als Schusseligkeit bezeichnen wir in der Umgangssprache die Anfälligkeit für kognitive Alltagsfehler. Deren Häufigkeit sagt wenig über die allgemeine geistige Kapazität einer Person aus.
Man kann Schusseligkeit messen, mit einem standardisierten Fragebogen namens Cognitive Failures Questionnaire, kurz CFQ. Der Fragebogen kann im Internet unter www.schusseligkeit.de ausgefüllt werden. Er misst die Auftretenshäufigkeit von 32 ausgewählten Alltagsfehlern. Für jedes Missgeschick schätzen die Befragten ein, wie oft es ihnen persönlich in den letzten sechs Monaten unterlief, von „nie“ bis „sehr oft“. Beispiel: Nach dem Verlassen der Wohnung musste ich noch einmal umkehren, um etwas zu holen, das ich versehentlich nicht eingesteckt hatte.“ Der größte Teil der Menschen befindet sich im mittleren Bereich, nur jeweils wenige Prozent sind besonders oder fast gar nicht schusselig. Das Alter der Teilnehmer*innen hat auf die Verteilung keinen großen Einfluss, allerdings neigen Frauen stärker als Männer dazu, sich selbst für schusselig zu halten. Aber Geist schützt nicht vor Schusseligkeit. In der Regel sind es monotone Tätigkeiten, die Patzer provozieren. Der Faktor Ablenkbarkeit schlägt hierbei stark zu Buche. Schusselige Menschen sind demnach anfälliger für Sorgen, Ängste und Stress und haben größere Probleme, sich zu organisieren, komplexere Handlungen zu planen und Dinge zu Ende zu bringen. Bei alledem spielen situative Faktoren natürlich eine wichtige Rolle. Menschen machen leichter Fehler, wenn sie müde oder schlecht gelaunt sind, wenn sie unter Zeitdruck stehen oder sich unsicher fühlen. Schusseligkeit fördert Autounfälle und leichtsinniges Verhalten.
Was kann man dagegen tun?
Seit Jahren sammeln X (Twitter)-Nutzer ihre kognitiven Alltagsfehler unter dem Hashtag „errordiary. Aus dieser Sammlung lassen sich folgende Strategien gegen Schusseligkeit ableiten:
- Gedächtnisstützen nutzen: Erinnerungsfunktionen am Handy aktivieren.
- Ähnliches trennen: Leicht zu verwendete Gegenstände getrennt aufbewahren.
- Zwischen-Check einplanen: Zwischendurch kontrollieren: Sind Handy, Schlüssel und Geldbörse in der Tasche, ehe ich weggehe?
- Aktionen abschließen: Behalten Sie das Portemonnaie in der Hand, bis die Karte verstaut ist.
- Redundanzen schaffen: Zweites Ladekabel deponieren, um nicht jedes Mal wieder daran denken müssen.
- Stress vermeiden: Der Koffer sollte besser in Ruhe am Vorabend gepackt werden als direkt vor der Abreise.
- Gewohnte Orte: Einfache Routinen statt langer Suche: Steckt der Wohnungsschlüssel von innen in der Tür, ist er stets griffbereit.
- Weitere Tipps: Einkaufszettel und To-do-Listen schreiben; waschbare Bezüge schützen Möbel vor Flecken, die aus Unachtsamkeit entstehen; zerbrechliche Gegenstände stellt man am besten dort ab, wo sie nicht leicht umfallen; Einparkhilfen beim Auto nutzen; automatische Abschaltfunktion bei Öfen; Gegenstände per GPS suchen.
Seien Sie aber beruhigt: Schusseligkeit ist ein normaler Teil menschlichen Verhaltens. Lediglich unter bestimmten Umständen weist Sie auf ein tiefer liegendes Problem hin. Nur eine starke Zunahme von Flüchtigkeitsfehlern binnen kurzer Zeit kann ein Indiz für eine psychische oder neurologische Erkrankung sein. So kann kognitiver Abbau auf beginnende Demenz hindeuten.
Sollte Ihnen in der Schule oder sonst wo ein kognitiver Fehler unterlaufen, hilft nur eines: darüber schmunzeln und beim nächsten Mal möglichst etwas besser aufpassen. Die Schüler*innen werden jedenfalls etwas zum Lachen haben.
Claudia Lengauer-Baumkirchner