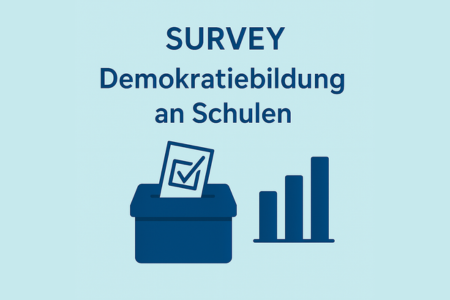Forschungsschwerpunkte
Begabungs- und Begabtenförderung in der Dualen Ausbildung
Forschungsteam
Ramona Uhl in Kooperation mit Ulrike Kempter (Member oft he General Committe of ECHA international; Vizepräsidentin ECHA Österreich), Gerda Pichler-Promberger
Kurzbeschreibung
Begabung wird als "Potenzial des Menschen zu außergewöhnlicher Leistung" definiert (iPege, ÖZBF). Das Erkennen von Potenzialen ist auch in der Berufsbildung sowohl eine große Herausforderung als auch eine große Chance. Deshalb wurde ein Beobachtungstool entwickelt, dass die Einschätzungen der Begabung, insbesondere der praktischen Intelligenz, im Kontext eines beruflichen Handlungsfeldes ermöglichen soll. Es wird angenommen, dass sich Begabung über verschiedene Kompetenzen zeigt, d.h. über Fähigkeiten, "in Situationen unter Berücksichtigung der personalen Handlungsvoraussetzungen und der äußeren Handlungsbedingungen Ziele zu erreichen und Pläne zu realisieren" (Hof, 2002, S. 85).
Es ist davon auszugehen, dass je nach Berufsfeld jeweils unterschiedliche Kompetenzen relevant sind. Um ein möglichst breites Spektrum an Berufen abzudecken, umfasst das entwickelte Tool verschiedene Kompetenzen zur Einschätzung des Potenzials des Lehrlings. Dabei werden auch Lernpräferenzen (Denkmodalitäten) abgefragt, denn "damit letztere (außergewöhnliche Leistung auch möglich ist, muss sich der Mensch auf einen lebenslangen Lern- und Entwicklungsprozess einlassen" (ÖZBF, FAQ). Was es braucht, um aus dem eigenen Lernpotenzial schöpfen zu können, darüber können einerseits Präferenzen der Denk- und Lernmodalitäten Auskunft geben, andererseits können daraus geeignete methodisch-didaktische Wege der Förderung abgeleitet werden. Ein in der Forschung wie in der Berufswelt dürftig behandelter Aspekt von Potenzialen ist der Wahrnehmungsaspekt. Da jedoch für gewisse Berufssparten eine hohe Sensitivität in manchen Bereichen geradezu eine Grundvoraussetzung für hohe Leistung darstellt, wurde der Faktor Hohe Sensitivität in die Einschätzung der Potenziale mit aufgenommen.
Im Einsatz in der dualen Ausbildung können Akteure der Berufsbildung in Schule und Betrieb einbezogen werden, um die Potenziale von Lehrlingen zu identifizieren und systematisch zu fördern. Das entwickelte Tool wird interdisziplinär und in verschiedenen Berufsfeldern diskutiert, und in Kooperation mit Partnern der Berufsbildungspraxis evaluiert. Ziel ist eine Stärkung der Begabungs- und Begabtenförderung in der dualen Ausbildung.
Projekte
- Entwicklung und Implementierung eines Potenzialerfassungsbogens zur Erhebung der praktischen Intelligenz im dualen System
- Review zum Stand der Forschung und Praxis der Begabungs- und Begabtenförderung
- Erstellen eines Leitfadens zur Erhebung der Begabungen im Beruf Bildhauer*in
- Begabungs- und Begabtenförderung in der Ausbildung der Pharmazeutisch-kaufmännischen Ausbildung
Publikationen
- Uhl, R. & Kempter, U. (2020) (PH Oberösterreich & ECHA International): Potenziale in der Berufsbildung erkennen, fördern und weiterentwickeln – eine Vision im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Umsetzung.https://www.bwpat.de/spezial-ph-at1/uhl_kempter_bwpat-ph-at1.pdf
- Kempter, U., & Uhl, R. (2017). Begabungs-und Begabtenförderung im dualen System in Österreich. In C. Fischer, C. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, F.-J. Mönks, & N. Neuber. Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt.: Beiträge aus der Begabungsforschung (S. 349-358). Waxmann
- Uhl, R., Kempter, U. & Dreer, S. (Hrsg.). (2013). Begabungs- und Begabtenförderung im dualen Ausbildungssystem. Linz: Trauner ISBN 978-3-99033-253-5
Wissenschafts-Praxis-Kooperation
- Netzwerk: Begabungs- und Begabtenförderung im dualen System
Bei Interesse an Kooperationen melden Sie sich bitte per Email:
Berufliche Übergänge und Diversität
Karin Heinrichs, Tanja Ramer, Johanna Schweiger, Marianne Schedlberger, Michaela Schinko, Anita Weissinger-Lusenberger
Kurzbeschreibung
Die erste Berufswahl und der Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. den Beruf ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe für Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Dieser erste Übergang in das Berufsleben legt die Grundlage für weitere berufliche Entscheidungen, für die (dauerhafte) Integration in das Erwerbsleben und die Teilhabe an der Gesellschaft. In diesem Forschungsschwerpunkt sollen Gelingensbedingungen beruflicher Übergänge im Laufe der Berufsbiographie. Ein besonderer Fokus liegt auf Personengruppen, die in besonderer Weise der Gefahr der Benachteiligung unterliegen und somit besonderer Unterstützung bedürfen. Wir beschäftigen uns vorwiegend mit Maßnahmen der Berufsorientierung und deren Wirkung, aber auch mit Fragen der beruflichen Identifikation mit dem Verbleibs in Beruf und Betrieb nach der Erstausbildung. Es werden Problemstellungen und Angebote der Bildungspraxis vor dem Hintergrund von theoretischen Ansätzen und empirischen Befunden diskutiert. Auch berufliche Übergänge im Erwachsenenalter wie von Lehrpersonen oder Professor:innen werden in den Blick genommen.
Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Lage und zu Perspektiven der (jungen) Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf in Österreich im Übergang Schule-Beruf zu gewinnen, besondere Herausforderungen zu identifizieren, Maßnahmen zu evaluieren und in Entwicklungsprojekten zur Verbesserung von deren Chancen beizutragen.
Der Fokus dieses FORVET-Schwerpunkts liegt auf den folgenden Themenbereichen:
- Berufsorientierung und Unterstützung im Übergang Schule-Beruf
Der Übergang Schule-Beruf ist für Jugendliche eine große Herausforderung. So bieten allgemeinbildende Schulen, aber auch Bildungsgänge der Ausbildungsvorbereitung (in Österreich die Polytechnische Schule) systematische und teilweise auch individualisierte Unterstützung der Berufswahl im Übergang Schule-Beruf, in eine duale Ausbildung oder in ein Studium. Unsere Studien zielen darauf ab, empirische Einblicke zu gewinnen, wie die Unterstützung der Berufsorientierung (insbesondere in der PTS) gelingt, inwiefern heterogene Ausgangslagen zu berücksichtigen sind und welche Schüler:innengruppen gegebenenfalls weiterer Unterstützung und multiprofessioneller Zusammenarbeit bedürfen.
- Prävention von Schul- und Ausbildungsabbruch in der Sekundarstufe 2
Früher Schul- und auch Ausbildungsabbruch sowie junge Menschen mit NEET-Status verweisen darauf, dass es Personen gibt, die aufgrund von Risikofaktoren Gefahr laufen, aus dem Bildungs- und Berufssystem zu fallen und für die der Weg in die berufliche und soziale Teilhabe herausfordernd ist. Es gilt dem frühen Bildungs- und Ausbildungsabbruch vorzubeugen. Schulen können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.
(1) Das Projekt ProLiSk untersucht, inwieweit die Förderung von Lebenskompetenzen dazu beitragen kann, frühen Schul- und Ausbildungsabbruch zu vermeiden. Untersucht werden hierzu auch Schüler:innen der Sekundarstufe 2 im Übergang Schule-Beruf und an der PTS.
(2) Ein Aktionsforschungsprojekt erfasst wie Berufsschulen in Oberösterreich aktuell Fehlzeiten von Lehrlingen in der Schulphase dokumentieren und (präventiv) Maßnahmen für den Lehrabbruch umsetzen. Es wird angestrebt, aus dieser Bestandsaufnahme Implikationen für die Lehrkräfteaus- und -fortbildung abzuleiten.
- Mentale Gesundheit im Übergang Schule-Beruf und der dualen Ausbildung
Seitdem sich die mentale Gesundheit der Jugendlichen durch die Corona-Pandemie verschlechtert hat, wird verstärkt der Ruf laut, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Wohlbefindens und der Gesundheitsförderung sein sollte. Psychische Probleme sind zudem Risikofaktoren im Übergang Schule-Beruf. Mit unseren Forschungsprojekten möchten wir mittels empirischer Studien dazu beitragen, die mentale Gesundheit der sowie deren personale und soziale Ressourcen der Jugendlichen im Übergang Schule-Beruf und der dualen Ausbildung zu erfassen, Maßnahmen zur Förderung psychischer Gesundheit von (benachteiligten) Jugendlichen zu evaluieren und Implikationen für die Bildungspraxis und Schulentwicklung abzuleiten.
- Beziehungsgestaltung in Schule als soziale Ressource der Lern- und Gesundheitsförderung insbesondere in beruflichen Übergängen
Soziale Beziehungen sind wichtige Ressourcen des Lehrens und Lernens, aber auch für Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsentwicklung und individuellen Förderung. Gelingt es also an Schulen wertschätzende, fürsorgliche und autonomieunterstützende Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler:innen, unter den Lernenden, den Lehrkräften und auch in der Schulgemeinschaft zu entwickeln, können diese zum Wohlbefinden der Beteiligten, zur Förderung von Basis- und Lebenskompetenzen auch bei Unterstützung bei heterogenen Ausgangslagen beitragen. Im Kontext der Berufsbildung aber wurde die Beziehungsgestaltung bisher wenig untersucht. Gleichzeitig aber unterscheiden sich die Bedingungen der Beziehungsgestaltung und die Zielgruppe von Vollzeitschulen der Primar- oder Sekundarstufe. Deshalb widmen wir uns in FORVET genau der Beziehungsgestaltung in Kontext der Berufsbildung an Lernorten Schule und Betrieb.
- Identifikation mit Beruf und Lehrbetrieb
Uns interessiert, wie sich berufliche Identifikation in der dualen Ausbildung entwickelt, welche Auswirkungen die Identifikation auf Arbeitszufriedenheit, Verbleib im Beruf und Betrieb und Performance hat und vor allem wie sich die berufliche Identifikation während der Berufsausbildung fördern lässt. Angenommen wird, dass die Qualität der Ausbildung im Lehrbetrieb hier großen Einfluss ebenso hat wie eine bereits informiert und selbstbestimmt getroffene Berufswahl bei Lehrbeginn. Bisherige Befunde zur beruflichen Identifikation bei Lehrlingen beruhen vor allem auf Querschnittanalysen, derzeit sind eine Längsschnittstudie und Analysen zur Entwicklung bei heterogenen Ausgangslagen in Vorbereitung.
- Image der dualen Ausbildung als Einflussgröße von Berufswahl und Verbleib in Beruf und Betrieb nach Lehrabschluss
In Österreich wird das Image der dualen Ausbildung ambivalent diskutiert: Zahlreiche Befunde sprechen für die Qualität und Wirksamkeit des Systems, zugleich wird der Lehre häufig ein geringes Ansehen zugeschrieben. Das Forschungsprojekt von Frau Schinko untersucht empirisch, in welchem Ausmaß das Image der dualen Ausbildung und einzelner Lehrberufe die Berufswahl aus Perspektive der Lehrlinge beeinflusst und inwiefern es den Verbleib im erlernten Beruf bzw. im Ausbildungsbetrieb nach Lehrabschluss prägt. Ziel ist es, fundierte Einblicke zu gewinnen, die zu einer differenzierten Einschätzung der Wirkung des Images auf Berufswahl sowie Verbleib im Beruf nach Lehrabschluss beitragen.
- Beruflichkeit und Bedingungen wissenschaftlicher Karrieren von Professor:innen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Die Herausforderung beruflicher Übergänge betrifft nicht nur junge Menschen. Im Laufe der Berufsbiografie über die Lebensspanne hinweg gibt es immer wieder berufliche Wechsel und Orientierungsphasen – auch auf dem Karriereweg zu einer Universitäts- oder Hochschulprofessur der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Ein Projekt untersucht insbesondere die Karrierewege und Ausprägung des Beruflichkeitsbewusstseins dieser Professor:innengruppe.
Aktuelle Publikationen / Vorträge
Berufsorientierung und Unterstützung im Übergang Schule-Beruf
Heinrichs, K., Forster-Heinzer, S., Kranert, H.-W., Joho, C., Stein, R. & Buchegger-Traxler, A. (2025). Teilhabe durch Stärkung der Transitionskompetenz im Übergang Schule-Beruf – ein Vergleich der Unterstützungsangebote in Deutschland, Österreich und Schweiz. DGfE-Sektionstagung Sonderpädagogik 22.-24.09.2025 in Heidelberg (Vortrag)
Niederfriniger, J. & Heinrichs, K. (2025). Das Potenzial zur Förderung beruflicher Zielklarheit und Berufswahlkompetenz an Polytechnischen Schulen in Österreich – Eine Diskussion von Befunden einer längsschnittlichen SchülerInnenbefragung im Lichte des Angebots-Nutzungs–Modells. In B. Gössling, A. Barabasch, J. Bock-Schappelwein & K. Heinrichs. (Hrsg.). Berufsbildung in Zeiten des Mangels – Handlungserfordernisse neu denken. Beiträge zur 9. Berufsbildungsforschungskonferenz (S. 125-137). Bielefeld: wbv; 10.3278/9783763978373
Brodsky, A., Heinrichs, K., Wuttke, E., Seeber, S., Seifried, J. & Niederfriniger, J. (2025). Berufsorientierung in Bildungsgängen der Ausbildungsvorbereitung in Deutschland und Österreich. In H. Welte, M. Thoma, H. Hautz & B. Gössling (Hrsg.), bwp@ Profil 11: Lern- und Forschungsräume im Wandel – Perspektiven der Wirtschafts- und Berufspädagogik. Digitale Festschrift für Annette Ostendorf zum 60. Geburtstag (S. 1–27). https://www.bwpat.de/profil10_ostendorf/brodsky_etal_profil10.pdf
Heinrichs, K., Niederfriniger, J., Bauer, J., Prammer, W., Telsnig, F. & Zenz, S. (2023). Diagnostik von Berufswahlkompetenz in Polytechnischen Schulen: Ein Schlüssel zur Vorbereitung einer heterogenen Schülerschaft auf selbstbestimmte Berufsentscheidungen in Zeiten von Transformation? R&ESource, 10 (4), https://doi.org/10.53349/resource.2023.i4.a1218
Obermeier, R., Heinrichs, K. & Prammer, W. (2022). Die Polytechnische Schule - ein unterschätzter Schultyp? Eine empirische Untersuchung zur Wahrnehmung der PTS durch Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern, R&ESource, 18, doi.org10.53349/resource.2022.i18.a1086
Prävention von Schul- und Ausbildungsabbruch in der Sekundarstufe 2
Mahringer, E., Redl, S., Kerzendorfer-Breithardt, M., Schlichtenhorst, J., Bacher, J., Heinrichs, K., Helm, C., Quenzel, G. & Weber, C. (2025). Prävention von Schulabbruch durch die Förderung von Lebenskompetenzen – Das Projekt „Promoting Life Skills“, Erziehung und Unterricht, März/April 3–4|2025
Weissinger-Lusenberger, A., Schedlberger, M. & Heinrichs, K. (2024). Die Erhebung und Analyse von Fehlzeiten in der Berufsschule als Beitrag zur Prävention von Lehrabbrüchen. Erste Ergebnisse eines Projektes der Aktionsforschung in Oberösterreich, Pädagogische Horizonte, 8(1), doi.org/10.17883/pa-ho-2024-01-09
Mentale Gesundheit im Übergang Schule-Beruf und der dualen Ausbildung
Heinrichs, K., Obermeier, R. & König-Ziegler, S. (2025). Mentale Sicherheit in Schule und Ausbildung. Präsentation aktueller wissenschaftlicher Ergebnisse mit Fokus auf den Ausbildungsbereich. 18.03.2025, Fachtagung Psychische Gesundheit und Berufseinstieg, Arbeiterkammer Oberösterreich Linz (Vortrag).
Heinrichs, K., Buchegger-Traxler, A. & Prammer, W. (2022). AusBildungspflicht bis 18 in Österreich – Eine Chance für psychisch belastete Jugendliche im Übergang Schule-Beruf? In R. Stein & H.-W. Kranert. Psychische Belastungen in der Berufsbiografie (S. 128-136). Bielefeld: wbv Media (Reihe Teilhabe an Beruf und Arbeit, Bd. 4).https://www.wbv.de/shop/themenbereiche/berufs-und-wirtschaftspaedagogik/shop/detail/6/_/0/1/6004904/facet/6004904///////nb/1/category/1634.html?cHash=6ff4176e3d79fdddf8d398674d5a1d5c#single-06575c7658026e94
Heinrichs, K., Weber, C., Schinko, M. & Gierlinger, J. Sozial-emotionale, psychische Problemlagen bei Lehrlingen in Österreich – erste Ergebnisse einer Bestandsaufnahme (2. Symposium Diversität in der beruflichen Bildung; 20.-21.01.2022, online)
Soziale Beziehungen in Schule als Ressourcen der Lern- und Gesundheitsförderung insbesondere in beruflichen Übergängen
Obermeier, R. & Heinrichs, K. (2025). Die Lehrkraft macht‘s? Die Bedeutung sozialer Beziehungen für die positive Einstellung von Lernenden zur Schule – Empirische Befunde zu Polytechnischen Schulen in Oberösterreich. In B. Gössling, A. Barabasch, J. Bock-Schappelwein & K. Heinrichs. (Hrsg.). Berufsbildung in Zeiten des Mangels – Handlungserfordernisse neu denken. Beiträge zur 9. Berufsbildungsforschungskonferenz (S. 199-211). Bielefeld: wbv; 10.3278/9783763978373
Obermeier, R., Schlesier, J. & Heinrichs, K. (2024). The mediating role of social relationships between perceived classroom management and adolescents’ attitudes toward school: a multilevel analysis, European Journal of Psychology in Education, https://doi.org/10.1007/s10212-024-00894-7
Identifikation mit Beruf und Lehrbetrieb
Wuttke, E., Heinrichs, K., Kögler, K. & Just, A. (2024). How Training Quality, Trainer Competence and Satisfaction with Training Affect Social Identification of Apprentices in Vocational Education Programs, Wuttke, E., Heinrichs, K., Kögler, K. & Hillen, S.A., Research Topic Professional and Vocational Identity Development, Frontiers in Psychology, Sec. Organizational Psychology Volume 15 - 2024 | doi: 10.3389/fpsyg.2024.1200279
Heinrichs, K., Wuttke, E. & Stock, M. (2023): Identifikation mit dem Beruf und mit den Lernorten Betrieb und Berufsschule – Ein Vergleich zwischen Auszubildenden aus Deutschland und Österreich. In bwp@ Profil 8: Netzwerke – Strukturen von Wissen, Akteuren und Prozessen in der beruflichen Bildung Digitale Festschrift für Bärbel Fürstenau zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Hommel, M./Aprea, C./Heinrichs, K., 1-25. Online: https://www.bwpat.de/profil8_fuerstenau/heinrichs_etal_profil8.pdf (14.09.2023).
Wuttke, E., Heinrichs, K., Kögler, K. & Hillen, S.A. (Eds.) (2023). Professional and Vocational Identity Development, Research Topic in Frontiers in Psychology, Sec. Organizational Psychology, https://www.frontiersin.org/research-topics/37143/professional-and-vocational-identity-development#overview
Image der dualen Ausbildung als Einflussgröße von Berufswahl und Verbleib in Beruf und Betrieb nach Lehrabschluss
Schinko,M. (2024). Image und Attraktivität der dualen Ausbildung in Österreich: Status quo und Wirkung auf den Verbleib im Beruf: Ein Scoping Review. Hrsg. Kögler, K.; Kremer, H.H. & Herkner, V. in Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung. S. 56 – 76. Barbara Budrich, Opladen, Berlin, Toronto. ISBN 978-3-8474-3054-4
Schinko, M. & Heinrichs, K. (2021). Die duale Berufsausbildung in Österreich im Spannungsfeld von Reputationsnarrativ und Evidenzbasierung - Die Reflexion impliziter Prestigevorstellungen von anerkannten Lehrberufen als individuelle und gesellschaftliche Herausforderung. Pädagogische Horizonte. 5(2), 293-315, ISSN 2523-5656 (Online) | ISSN 2523-2916
Beruflichkeit und Bedingungen wissenschaftlicher Karrieren von Professor:innen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Ziegler, B., Wuttke, E. & Heinrichs, K. (2024). Professor:innen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik – Wissenschaftliche Karrieren im Spiegel der Disziplingenese.
In K. Büchter, V. Herkmer, K. Kögler, H.-H. Kremer, U. Weyland (Hrsg). 50 Jahre Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik in der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft: Kontinuität, Wandel und Perspektiven. Verlag Barbara Budrich. ISBN: 978-3-8474-2720-9
Wissenschafts-Praxis-Kooperation
Bei Interesse an Kooperationen zu Themen der Pädagog*innenbildung im Bereich Berufspädagogik wenden Sie sich bitte per E-Mail an Karin Heinrichs (karin.heinrichs@ph-ooe.at)
Konnektivität in der Dualen Ausbildung
Forschungsteam
Oskar Redhammer, Johanna Pichler, Christian Flotzinger
Kurzbeschreibung
Die duale Ausbildung liefert in Österreich seit Jahrzehnten einen unverzichtbaren Beitrag zur Fachkräfteausstattung. Trotzdem gibt es Raum für Verbesserungen. So zeigt sich für die Kooperationstätigkeit zwischen den beiden Lernorten Berufsschule und Betrieb, insbesondere auf der Mikroebene, Handlungsbedarf. Lernortkooperation im dualen System, also die Verbindung zwischen der schulischen und betrieblichen Welt, wird in der Fachliteratur mit dem Begriff Konnektivität umschrieben. Das Ziel besteht darin, konnektive Lernanlässe zu schaffen, um die gelernten Inhalte an beiden Lernorten besser zu verknüpfen. Folgende Forschungsfragen bilden die Grundlage für die Forschungstätigkeiten:
- Wie und unter welchen Voraussetzungen sind konnektive Lernanlässe realisierbar?
- Welchen Beitrag können konnektive Lernanlässe zur Verbesserung der Kooperation der Lernorte Berufsschule und Betrieb leisten?
- Welche methodisch-didaktischen Elemente können basierend auf theoretischen und empirischen Befunden für den Entwurf eines konnektiven Lernjournals zur Verbesserung der Konnektivität im dualen System abgeleitet werden?
- Wie können konnektive Lernjournale für die duale Ausbildung konzipiert und eingesetzt werden?
Publikationen:
- Flotzinger, C. W. & Rechberger J. (2019). Kooperative Lernerlässe zur Verbesserung der Konnektivität im dualen System, In: Beiträge zur 6. Berufsbildungsforschungskonferenz (BBFK). Bielefeld: wbv Publikation.
- Flotzinger, C. W. & Pichler J. (2020). Das duale System als Spannungsfeld. Zwischen systemischer Qualität und institutioneller Autonomie In: Rainbacher P., Oberneder J., Wesenauer A. (Hrsg.). Warum Komplexität nützlich ist. Springer. Wiesbaden. S.151-169.
- Redhammer O., Pichler J. & Flotzinger C. W. (2023). Das konnektive Lernjournal als didaktisches Instrument zur Verbesserung der Konnektivität sowie der Lernortkooperation in der dualen Ausbildung.
Wissenschafts-Praxis-Kooperation
Bei Interesse an Kooperationen melden Sie sich bitte per Email:
Qualitätsentwicklung und Digitalisierung in der Pädagog*innenbildung der Berufspädagogik
Forschungsteam
Nora Cechovsky, Johanna Pichler, Elisabeth Dizili
Kurzbeschreibung
Die Professionalisierung von Pädagog*innen im Bereich der Berufspädagogik stellt eine zentrale Aufgabe des Instituts für Berufspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich dar. In diesem Kontext werden seit dem Studienjahr 2020/21 Studiengänge mit einem erhöhten Anteil an Fernlehre angeboten, die zugleich wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden.
Im Zentrum dieses Forschungsschwerpunkts stehen aktuelle Fragestellungen der Pädagog*innenbildung im Bereich der Berufspädagogik. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Hochschullehre und zur Professionalisierung von Lehrkräften zu gewinnen. Der Fokus liegt derzeit insbesondere auf zwei Themenbereichen:
- Online-Lehre: Im Rahmen der digitalen Hochschullehre untersuchen wir die Gestaltung von Online-Phasen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung sozialer und kognitiver Präsenz durch die Lehrpräsenz im Online-Setting. Hierbei orientieren wir uns am Community of Inquiry Framework, das als theoretische Grundlage für die Entwicklung und Analyse von Online-Lernumgebungen dient.
- Künstliche Intelligenz (KI): Ein weiterer Schwerpunkt ist der sinnvolle Einsatz von KI-Technologien in der Hochschullehre. Wir erforschen sowohl die praktischen Einsatzmöglichkeiten als auch die Akzeptanz und Nutzung durch Lehrkräfte. Zudem entwickeln wir hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote, die Lehrpersonen den reflektierten und kompetenten Umgang mit KI in der Lehre ermöglichen sollen.
Publikationen
- Cechovsky, N., & Malli-Voglhuber, C. (2025). Von der Hochschule ins Klassenzimmer: Die Rolle der KI in der Lehrer:innenbildung. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 20(SH-KI-2), 143–164. https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-KI-2/08
- Cechovsky, N., Malli-Voglhuber, C., & Pichler, J. (2023). Förderung der sozialen Interaktion in der Distance-Hochschullehre – Ergebnisse einer Evaluations-studie im Masterstudium Educational Media an der PH OÖ. In M. Miglbauer (Hrsg.), Hochschullehre in großen und kleinen Gruppen. Tagungsband zur 6. Online-Tagung Hochschule digital.innovativ (S. 170–176). PH Burgenland. https://www.ph-burgenland.at/fileadmin/Forschung/Hochschulschriften/digiPH6_FINAL.pdf
- Cechovsky, N., & Pichler, J. (2023). Online-Lehre in Lehramtsstudien der Berufsbildung. Methodik, Didaktik und Gestaltung der Lehrveranstaltungen. In A. Pausits, M. Fellner, E. Gornik, K. Ledermüller, & B. Thaler (Hrsg.), Uncertainty in Higher Education: Hochschulen in einer von Volatilität geprägten Welt (S. 87–100). Waxmann. https://elibrary.utb.de/doi/epdf/10.31244/9783830996880
- Cechovsky, N., Pichler, J., & Schaferl, K. (2022). Soziale Interaktion und Soziale Präsenz in der Distanz- und Präsenzlehre an der Hochschule. In G. Schutti-Pfeil, A. Darilion, & B. Ehrenstorfer (Hrsg.), Tagungsband, 10. Tag der Lehre der FH OÖ, Hochschuldidaktik gestern – heute – morgen (S. 48–58). FH Oberösterreich. https://pure.fh-ooe.at/ws/portalfiles/portal/42214189/FHO_22_Tag_der_Lehre_Tagungsband_A5_221006bo_WEB.pdf
Wissenschafts-Praxis-Kooperation
Bei Interesse an Kooperationen zu Themen der Pädagog*innenbildung im Bereich Berufspädagogik wenden Sie sich bitte per E-Mail an Nora Cechovsky (Nora.Cechovsky@ph-ooe.at).
Finanzbildung an berufsbildenden Schulen
Forschungsteam
Nora Cechovsky, Wolfgang Kaiser-Mühlecker
Kurzbeschreibung
Im Herbst 2021 wurde in Österreich eine nationale Finanzbildungsstrategie präsentiert. Diese Strategie zielt darauf ab, die finanzielle Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, um negative Auswirkungen fehlender Finanzkompetenz – wie etwa Überschuldung – zu vermeiden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zielgruppe der 6- bis 19-jährigen Schüler*innen, zu denen auch die Lehrlinge zählen. Obwohl die finanzielle Kompetenz von Lehrlingen und die Rolle der Finanzbildung an Berufsschulen für die berufliche und private Zukunft der Jugendlichen entscheidend sind, wurde diesem Bereich bisher wenig Aufmerksamkeit im Forschungskontext gewidmet. Unser Forschungsschwerpunkt setzt genau hier an, um diese Lücke zu schließen. Dabei fokussieren wir uns insbesondere auf folgende Bereiche
- Interviewstudien mit Lehrpersonen an Berufsschulen: Um ein umfassendes Bild zu erhalten, führen wir Interviewstudien mit Lehrpersonen durch. Diese Studien sollen Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und den Bedarf an Unterstützung im Bereich der Finanzbildung geben.
- Erhebung des Stands der Financial Literacy von Jugendlichen: Wir erheben den aktuellen Stand der Financial Literacy bei Schülerinnen und Schülern, um gezielt Maßnahmen entwickeln zu können, die deren finanzielle Kompetenz verbessern.
- Analyse von Fehlkonzepten: Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Fehlkonzepten der Schüler*innen im Bereich Finanzen. Diese Fehlkonzepte werden identifiziert und im Unterricht gezielt adressiert, um ein tieferes Verständnis und eine fundierte Finanzkompetenz zu fördern.
Publikationen
- Cechovsky, N. (2025). Exploring the Didactic Principles of Vocational Teachers in Financial Education: An Interview Study. International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 12(3), 360–382.https://doi.org/10.13152/IJRVET.12.3.3
- Cechovsky, N. & Kaiser-Mühlecker, W. (2025). Der Einsatz wissenschaftlicher Erhebungsinstrumente zur datenbasierten Unterrichtsentwicklung am Beispiel von Financial Literacy. R&E-Source, 11(4), 4–21. https://doi.org/10.53349/resource.2024.i4.a1346
- Fuhrmann, B., Cechovsky, N. & Riess, J. (2025). Wer bei finanzieller Bildung spart, zahlt einen hohen Preis. Was Finanzbildung ist und welche vulnerablen Gruppen sie besonders brauchen. EB Erwachsenenbildung, 70(4), 148–150. http://dx.doi.org/10.13109/erbi.2024.70.4.148
Wissenschafts-Praxis-Kooperation
Bei Interesse an Kooperationen zu Themen der Finanzbildung wenden Sie sich bitte per E-Mail an Nora Cechovsky (nora.cechovsky@ph-ooe.at).
Demokratie-, Werte- und Moralerziehung in der Berufsbildung
Karin Heinrichs, Tanja Ramer, Johanna Schweiger
Kurzbeschreibung
Berufsbildende und auch die Berufsschulen leisten einen Beitrag zur Demokratie- und Umwelterziehung der Jugendlichen. Zudem sollten zukünftige Fachkräfte auf den Umgang mit ethischen Herausforderungen im Beruf vorbereitet werden. Sie sollten in der Lage sein, berufliche Ideal- und Wertevorstellungen zu entwickeln und unter gegebenen, teils restriktiven Bedingungen und Vorgaben (z.B. des Unternehmens/der Institution) zu balancieren, Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten und Verantwortung abzuwägen sowie in den gegebenen Spielräumen verantwortungsvoll und ethisch angemessen zu handeln. In diesem Forschungsschwerpunkt interessiert uns, wie (zukünftig) Berufstätige darauf vorbereitet werden können, Entscheidungen in moralrelevanten Situationen zu begründen und in Übereinstimmung mit ihren Urteilen zu handeln. In diesem FORVET-Forschungsschwerpunkt werden Fragestellungen der moralpsychologischen Grundlagenforschung zu Entscheiden und Handeln in ethisch relevanten Situationen ebenso diskutiert wie Konzepte der Demokratie-, Moral- und Umwelterziehung in beruflichen Kontexten entwickelt, implementiert und evaluiert.
Der Fokus unserer Forschung liegt insbesondere auf den folgenden Themenbereichen:
- Didaktische Gestaltung von Diskussionen zu ethischen Konflikten im Beruf
Dilemmadiskussionen sind wichtige Methoden der Moral- und Demokratieerziehung. Das Unterrichtskonzept Values and Knowledge Education (VaKE) inkludiert solche Dilemmadiskussionen und erlaubt es sowohl moralische Urteilskompetenzen als auch Fachwissen zu fördern. Allerdings ist bisher kaum untersucht, inwiefern VaKE auch Entscheiden und Handeln in beruflich relevanten ethischen Konfliktsituationen fördern kann und welche Qualität die im Setting zentralen Diskurse in den Kleingruppen aufweisen. Eine quasi-experimentell angelegte Interventionsstudie erlaubt hier tiefere Einblicke.
- Lehrkräfteethos
Auch Lehrkräfte stehen immer wieder ethisch herausfordernden Situationen gegenüber. Der Begriff des Lehrkräfteethos bezeichnet eine werteorientierte Haltung, die sich im professionellen Handeln der Lehrpersonen zeigt. In ethischen Konflikten geht es zudem darum Position zu beziehen und gut begründet ethische Entscheidungen zu treffen. In unseren Arbeiten fokussieren wir die Sozialfacette des Ethos von Berufspädagog:innen und betrieblichen Ausbilder:innen. Es wird untersucht, welche professionellen Vorstellungen die Lehrenden mit Blick auf die Gestaltung der Lehrkräfte-Schüler:innen-Beziehung und der Gestaltung sozialer Beziehungen unter den Lernenden verinnerlicht haben, wie sie diese in ihrem Handeln in berufsbildenden Schulen implementieren und wie sich Lehrkräfteethos fördern lässt.
- Kooperation in beruflichen Kontexten: Gelingensbedingungen und ethische Herausforderungen
Kooperation im Beruf ist allgegenwärtig: ob Teamarbeit am (digitalen) Arbeitsplatz, unter Lehrkräften oder in Gruppearbeiten in Lehr-Lern-Umgebungen der Berufsbildung oder der Hochschullehre. Kooperation aber gelingt nicht immer. Vielmehr steht Kooperation im Spannungsfeld zwischen Eigen- und Gemeinschaftsinteressen. Phänomene des Free Riding oder Social Loafing weisen auf ethische Herausforderungen in kooperativen Settings hin. Wir interessieren uns in unseren Arbeiten für grundlegende Mechanismen (digitaler) Kooperation vor allem aus verhaltensökonomischer Perspektive. Es wurde ein digitales Kooperationsspiel entwickelt, das sowohl für experimentelle Forschung als auch als Kooperationslernspiel eingesetzt werden soll.
- Happy Vicitimizer im Erwachsenenalter
In ethischen Konfliktsituationen professionell zu handeln bedeutet nicht nur Handlungsoptionen ethisch rational zu reflektieren. Das Handeln wird vielmehr ebenso zentral von (moralischen) Emotionen geleitet. Wie Emotion und Kognition in ethischen Konflikten zusammenwirken können, verdeutlichen Muster, die zunächst nur bei Kindern, inzwischen aber auch für Erwachsene in wirtschaftlichen und beruflichen Kontexten identifiziert werden konnten: So kennzeichnet das Muster des Happy Victimizers Konstellationen, in denen eine Person eine moralische Regel übertritt, sich dabei aber gut fühlt; das Pattern des „Happy Moralist“ dagegen eine Person, die sich mit positiven moralischen Gefühlen bei einer Regeleinhaltung gut fühlt. Die hier inzwischen erzielten Erkenntnisse der Grundlagenforschung sollen in Zukunft in spezifischen Kontexten wie der Kooperation im Beruf weiteruntersucht werden.
Aktuelle Publikationen / Vorträge
Didaktische Gestaltung von Diskussionen zu ethischen Konflikten im Beruf
Heinrichs, K., Siegfried, C. & Weinberger, A. (2023). Potentiale der Unterrichtskonzeption VaKE (Values and Knowledge Education) in der Berufsbildung – erste Befunde einer Interventionsstudie. In R. Bauer, E. Süss-Stepancik & R. Petz (Hrsg.), Perspektiven auf die Berufsbildung: Rück- und Ausblick. Forschungsperspektiven Sonderband 5 (S. 85-103). LIT Verlag. https://doi.org/10.52038.9783643511355_5
Siegfried, C. & Heinrichs, K. (2020): Ansätze problembasierten, kooperativen Lernens zur Förderung ökonomischer und moralischer Kompetenzen – eine Pilotstudie bei angehenden Bankkaufleuten. In: bwp@ Profil 6: Berufliches Lehren und Lernen: Grundlagen, Schwerpunkte und Impulse wirtschaftspädagogischer Forschung. Digitale Festschrift für Eveline Wuttke zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Heinrichs, K./Kögler, K./Siegfried, C., 1-26. Online: https://www.bwpat.de/profil6_wuttke/siegfried_heinrichs_profil6.pdf (08.09.2020).
Lehrkräfteethos
Heinrichs, K. & Albert S., (2024). Pädagogisches Handeln im Spannungsfeld von Autorität und Autonomie – Theoretisch und empirisch fundierte Impulse, Erziehung und Unterricht, 2024(1), S. 100-109
Oser, F., Heinrichs, K., Bauer, J. & Lovat, T. (Eds.). (2021). International Handbook of Teachers‘ Ethos. Strengthening Teachers, Supporting Learners. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73644-6
Heinrichs, K., Ziegler, S. & Warwas, J. (2021). Teacher ethos as intention to implement appreciation in teacher-student relations—A closer look at underlying values and behavioral indicators. In F. Oser, K. Heinrichs, J. Bauer & T. Lovat (Eds.). International Handbook of Teachers‘ Ethos. Strengthening Teachers, Supporting Learners (237-260). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73644-6_15
Heinrichs, K. & Ziegler, S. (2018). Commitment to develop appreciative relationships in school. Nonviolent communication as an approach to specify a facet of teacher ethos. In A. Weinberger, H. Biedermann, J.-L., Patry & S. Weyringer (Eds.). Professionals Ethos and Education for Responsibility (pp. 137–149) [Series Moral Development and Citizenship Education, Band: 14]. Rotterdam: Sense Publisher
Kooperation in beruflichen Kontexten: Gelingensbedingungen und ethische Herausforderungen
Heinrichs, K., Minnameier, G. Gutzwiller-Helfenfinger, E. & Schadt, C. (2025). Zusammenarbeit gelingt nicht von selbst – Ein digitales Kooperationslernspiel mit wirtschaftsberuflichem Kontext. Jahrestagung der DGfE-Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik 24.-26.09.2025 in Darmstadt.
Minnameier, G., Gutzwiller-Helfenfinger, E., Heinrichs, K., Schadt, C. & Mutz, U. (2025). Kooperation im Spannungsfeld individueller Vorteile und Teamerfolg. Ein digitales Kooperationsspiel in Vorbereitung, Tagung der Moralforscher:innen, 09.-11.01.2025 Leipzig.
Heinrichs, K., Ziegler, S., Klaus, J., Reinke, H. (2019): Lerngruppen als didaktische Antwort auf Leistungsheterogenität im Unterricht? – Hypothesen zu emotionalen und motivationalen Barrieren bei Gruppenarbeiten. In K. Heinrichs & H. Reinke (Hrsg.). Heterogenität in der beruflichen Bildung. Im Spannungsfeld von Erziehung, Förderung und Fachausbildung (S. 149-165). Reihe Wirtschaft – Beruf - Ethik, wbv-Verlag: Bielefeld.
Happy Victimizer im Erwachsenenalter
Gutzwiller-Helfenfinger, E./Heinrichs, K./Schadt, C./Latzko, B. (2022): Eine nicht triviale Frage: Braucht es Konstrukte der Emotion und Motivation, um das Happy Victimizer Pattern zu erklären? In: bwp@ Profil 7: Perspektiven wirtschafts- und berufspädagogischer sowie wirtschaftsethischer Forschung. Digitale Festschrift für Gerhard Minnameier zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Hermkes, R./Bruns, T./Bonowski, T., 1-35. Online: https://www.bwpat.de/profil7_minnameier/gutzwiller-helfenfinger_etal_profil7.pdf (12.06.2022).
Gutzwiller-Helfenfinger, E. & Heinrichs, K. (Eds.) (2020). Frontline Learning Research, Special Issue Happy Victimizer Phenomenon, 8(5), ISSN 2295-3159
Heinrichs, K., Gutzwiller-Helfenfinger, E., Latzko, B., Minnameier, G. & Döring, B. (2020): Happy-Victimizing in adolescence and adulthood – Empirical findings and further perspectives, Frontline Learning Research, 8(5), 5-23, https://doi.org/10.14786/flr.v8i5.385
Heinrichs, K., Kärner, T., & Reinke, H. (2020). An action-theoretical approach to the ‘Happy Victimizer’ Pattern – Exploring the role of moral disengagement strategies on the way to action, Frontline Learning Research, 8(5), 24-46. doi: https://doi.org/10.14786/flr.v8i5.386
Heinrichs, K., Schadt, C. & Weinberger, A. (2019). Moralische Entscheidungen in beruflichen Kontexten – Empirische Befunde und Perspektiven für die berufliche Bildung, BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Heft 4, Themenheft “Werte in der Berufsbildung”, 14-18
Heinrichs, K., Minnameier, G., Latzko, B. & Gutzwiller-Helfenfinger, E. (2015). „Don’t worry, be happy“? – Das Happy-Victimizer-Phänomen im berufs- und wirtschaftspädagogischen Kontext, Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 111. Band, Heft 1 (2015), 32-55
Wissenschafts-Praxis-Kooperation
Bei Interesse an Kooperationen zu Themen der Pädagog*innenbildung im Bereich Berufspädagogik wenden Sie sich bitte per E-Mail an Karin Heinrichs (karin.heinrichs@ph-ooe.at)